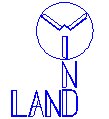 Telefon: 030/ 65 01 77
01
Telefon: 030/ 65 01 77
01
Windland Energieerzeugungs GmbH
Grimmstraße 9, 10967 Berlin/
Geschäftsstelle Region 17
Postfach 1563
82455 Garmisch-Partenkirchen
Ihre Nachricht vom /Bearb.: Bearbeiter: Durchwahl: e-Brief: Datum:
Joachim Falkenhagen 030/ 65 01 77 01 falkenhagen5@meerwind.de 19.03.2013
[Vorab per Email an region17@lra-gap.de]
9.
Fortschreibung des Regionalplans Oberland / Teilfortschreibung Windkraft
Sehr
geehrte Damen und Herren,
die
grundlegenden Ziele und Überlegungen der Regionalplanung und des Entwurfs
werden hier geteilt, sind aber zu ergänzen, was im Ergebnis wesentliche
Änderungen nahe legt.
A. Fernwirkung,
großräumige Konzentration
Zwei
weitere Ziele werden durch die Planungen nicht hinreichend berücksichtigt:
1.
Freihaltung größerer
Teile des Planungsgebiets von Sichtbeziehungen mit Windkraftanlagen, auch
soweit es sich um Sichtbeziehungen in der Fernwirkung handelt.
2.
Freihaltung besonders
bedeutender Sichtbeziehungen bzw. Sichtachsen, insbesondere bei den Seen.
Dies
beruht offenbar auf einer Unterschätzung der Fernwirkung der Windenergieanlagen
bzw. Windparks.
Vorgeschlagen
wird daher eine stärkere Ausprägung der ohnehin gegebenen Konzentration von
Windparks in wenigen Teilen der Planungsregion. Die Konsequenz ist, dass auf
kleinere bzw. isoliert gelegene Standorte verzichtet wird. Auch wenn diese im
Nahbereich sinnvoll erscheinen, sind sie wegen ihrer Fernwirkung kritisch zu
betrachten.
Das
heißt, die bisherigen Auswahlkriterien werden im Grundsatz befürwortet, geben sie
doch einen guten Überblick darüber, wo Windparks in ihrem Nahbereich (bis ca. 2
km Abstand) verträglich wären. In einem zweiten Auswahlschritt sollte nun aber
eine großräumige Betrachtung erfolgen, bei der insbesondere solche Gebiete
ausscheiden, die isoliert liegen im Vergleich zu den übrigen, im ersten
Durchgang geeignet erscheinenden Gebiete.
20
Hektar sind als Mindestwert auch allzu niedrig gewählt. Dies würde lediglich
ca. vier Windkraftanlagen entsprechen. Mit solch kleinen Projekten würde die
„Verspargelung“ der Landschaft sehr deutlich verschärft werden, sollen trotzdem
bestimmte energiewirtschaftliche Ziele erreicht werden.
B. Arrondierung
durch Anwendung der Regel-Abstände
Zum
Ausgleich sollte dort, wo ohnehin Planungen vorgesehen sind, möglichst eine
Arrondierung der Flächen erfolgen. Dies würde dort und vor allem weiträumig nur
wenig zusätzliche Belastungen des Landschaftsbildes bewirken.
Zu
diesem Zweck sollte in solchen Fällen insbesondere auf den „Zuschlag“ von 200
Metern zu den von Wohnbauflächen einzuhaltenden Abständen (1000 Meter statt 800
Meter laut Windkrafterlass, bzw. 700 Meter statt 500 Meter in weniger
empfindlichen Fällen) verzichtet werden. Es würde auch der Rechtssicherheit des
Plans dienen, wenn keine „willkürlich“ erscheinenden, pauschalen Vergrößerungen
von landesweit akzeptierten Abstandsflächen vorgenommen werden. Eine
Abstandsvermehrung von 800 auf 1000 Meter bringt auch nur eine minimale
Lärmminderung. Auch die zusätzliche Geräuschbelastung dadurch, dass bei
geringeren Abständen mehr WEA in einem Eignungsgebiet möglich sind, bzw. dadurch
zusätzlich zu ersten Reihe auch die zweite Reihe um 200 Meter näher heranrückt,
ist relativ gering, zumal ja in jedem Fall die Grenzwerte des BImSchG einzuhalten
sind.
In
Norddeutschland haben sich Landwirte mitunter auch dazu entschlossen, bestimmte
Aussiedlerhöfe als Wohnstandorte aufzugeben (und nutzen sie nur noch als
Wirtschaftsgebäude), um damit eine sinnvolle Arrondierung von Windparkflächen
(im Eigentum desselben Landwirts) zu ermöglichen. Solche
Entwicklungsmöglichkeiten sollte der Plan ebenfalls antizipieren. Damit
können im Einzelfall „Kreise“ um
Aussiedlerhöfe in die benachbarte Eignungsfläche einbezogen werden. Natürlich
hat der jeweilige Landwirt immer ein Bestandsrecht, das sich aus dem BImSchG
und meistens auch aus den Grundstückseigentumsverhältnissen ergibt, wäre also
niemals zur Verwirklichung eines Windkraft-Entwicklungspotentials in Hofnähe
verpflichtet. Die entsprechenden Flächen können als zusätzliche „Weißflächen“
aufgenommen werden, um den bedingten Charakter solcher Umwidmungen zu
verdeutlichen.
Der
Grundsatz, dass nur Flächen berücksichtigt werden sollen, die mindestens 20
Hektar (oder besser mehr) jenseits der 1000 Meter-Linien aufweisen, braucht
deshalb nicht aufgegeben werden. Mit einem Heranrücken an Siedlungen begrenzter
Größe bis auf 800 Meter würden die Einzelflächen dann dennoch größer werden.
C. Waldgebiete
Kritisch
zu sehen ist weiterhin das Ausmaß der Konzentration der Planungen auf
Waldgebiete. Dies hat – neben wirtschaftlichen Nachteilen für die Betreiber –
zur Folge, dass für einen vergleichbaren Ertrag höhere Nabenhöhen benötigt werden
und damit auch eine stärkere visuelle Fernwirkung erreicht wird. In einigen
Fällen hätte ein Heranrücken auf 800 Meter an Siedlungen auch den Effekt, dass zusätzliche Offenlandstandorte
gewonnen werden können. Wenn diese Standorte dann beispielsweise 20 Meter
niedriger bebaut würden als die Waldstandorte, würde auch in den Siedlungen
eine kaum größere visuelle Beeinträchtigung entstehen.
D. Einzelvorschläge
- Östlicher Teil der Region:
Gebiet 1: Erweiterung nach Osten, die 700 Meter Linie wird
hier vermutlich durch einzelne Gehöfte bestimmt, nicht durch den 1000
Meter-Abstand zu den kleinen Ortschaften Ingenried bzw. Sachsenried. Ein
Abstand von 1.000 m zu einem „Sondergebiet "Holzlager" in Ingenried“
ist wohl nicht erforderlich.
Dieses
Gebiet ist vor allem dann positiv zu bewerten, wenn eine Erweiterung östlich
angrenzend im benachbarten Planungsraum möglich wäre und auch die Weißfläche
überbaut werden kann.
Gebiete 2, 3 und 5: Diese Gebiete stellen relativ isoliert gelegene
„Inseln“ dar, die dem gesamten Raum zwischen Schongau und Bernbeuren einen von
Windenergie mitgeprägten Charakter aufprägen würden und insbesondere im
Sichtbereich der Ortschaften Schongau und Peiting liegen, diese gleichsam
einkreisen.
Die
energiewirtschaftliche Bedeutung ist wegen mäßiger Größe begrenzt (148 ha + 117
ha + 105 ha). Daher streichen.
Gebiet 6: Wie vorstehend, allerdings wegen noch geringerer
Größe (41 ha) und dem größeren Abstand zu den sinnvollen Flächen 1 und 4
(künftige Vorbelastung) noch negativer zu sehen.
Unbedingt
geprüft werden sollte, ob eine Sichtbeziehung zwischen der Zuwegung zur
Wieskirche (genaugenommen vom Kirchenvorplatz und bis einige hundert Meter
entfernt auf dem Rückweg, nördliche Blickrichtung) und diesem Eignungsgebiet
bestünde.
Weißfläche
nördlich des Gebiets 6: Falls diese bleibt, sollten Radien um Einzelgehöfte
vermindert werden.
E. Mittlere
Teile der Region:
Gebiet 7: Bei Möglichkeit der Arrondierung Gebiet vergrößern,
sonst ggf. streichen.
Gebiete 8 bis 10: Diese befinden Sich unmittelbar in der
Blickbezeiehung von Herrsching über den Ammersee hinweg. Auch die Sicht vom
überregional bedeutenden Ausflugsziel Kloster Andechs würde beeinträchtigt
werden. Streichen
Gebiete 11 und 12: Streichen wegen isolierter Lage in einem sonst nicht
durch WEA vorbelasteten Umfeld; mögliche Sichtbeziehung von Starnberg über den
See hinweg, wahrscheinlich Sichtbeziehungen vom Südostrand des Starnberger See
über diesen hinweg, sichere Beeinträchtigung der Sichtbeziehungen am Staffelsee
und am Riegsee. Mäßige energiewirtschaftliche Bedeutung mit 63 + 175 ha.
Gebiet 13 und Weißfläche südlich von Eurasburg:
Dies
sind wohl die ungünstigsten Planungsvorschläge insgesamt, wegen ihrer visuellen
Fernwirkung.
Wegen
der Höhenlage in vermutlich rund 80-90 Meter oberhalb des Starnberger Sees
(westlich) bzw. oberhalb der Talräume südlich Wolfratshausens (weiter östlich fast
ebenso so große Höhendifferenz) wird die Fernwirkung der an sich „nur“ knapp 200
Meter hohen Anlagen bei weitem verstärkt.
Beeinträchtigt
würden insbesondere sämtliche Sichtbeziehungen von Tutzing, Feldafing und
Pöcking aus auf den Starnberger See bzw. den gegenüberliegenden Höhenzug,
einschließlich wohl der Unesco-Stätte auf der Roseninsel.
Die
Aussage im Umweltgutachten „Geringe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu
erwarten“ ist völlig unangebracht und belegt, dass sich dieses Gutachten
lediglich auf die Wirkungen im Nahbereich bis ca. 2 km beschränkt und die
Fernwirkungen völlig ausblendet.
Gebiet
13 könnte mit 20 ha maximal drei oder vier Windturbinen aufnehmen, so dass sich
ein besonders ungünstiges Verhältnis zwischen visueller Wirkung und energiewirtschaftlichem
Nutzen ergäbe.
Auch
muss sich auch vor Augen halten, dass für den Fall einer deutlichen
Verminderung des Zubautempos für WEA infolge von Änderungen des EEG dieser
Standort (der ungünstigste des Planungsraums) möglicherweise wegen besonders
günstiger Windverhältnisse auf den Höhenzug noch am ehesten verwirklicht würde.
Die angegebene Entfernung von 2,7 km zur nächstgelegenen 110 kV-Leitung ist
irrelevant, weil für drei bis vier Windräder kein eigenes Umspannwerk gebaut
würde, sondern eine Einbindung in das 20 kV-Netz erfolgen würde oder bestenfalls
ein Kabel zum nächsten schon bestehenden Umspannwerk verlegt würde.
Gebiete 14 und 15: Diese Gebiete stellen relativ isoliert gelegene
„Inseln“ dar, die dennoch dem gesamten Raum zwischen Wolfratshausen und
Königsdorf dieser einen von Windenergie mitgeprägten Charakter aufprägen würden.
Dies beeinträchtigt auch die Blickbeziehungen vom Höhenzug westlich von Wolfratshausen /Eurasburg in
die Talebene.
Geringe
energiewirtschaftliche Bedeutung mit Platz für zusammengerechnet maximal 10
Anlagen.
F. Östlicher
Teil der Region:
Gebiet 25: Ablehnung mit Begründung entsprechend Gebieten 14
und 15, außer im Fall von Erweiterungsmöglichkeiten im Nachbarlandkreis.
Gebiete 16 bis 19 und 24: Hierbei handelt es sich um Gebiete mittlerer Größe
(80 ha + 33 ha + 109 ha + 126 ha und 98 ha), die zwar nicht isoliert in einem
windparkfreien Raum stehen (wenn man die größeren Gebiete 20, 22 und 23 als
„gesetzt“ betrachtet), aber doch an dessen Rande. Somit würden sie den von
Windparks deutlich mitgeprägten Raum doch substantiell erweitern. Auch im
Hinblick auf die Funktion des weiträumigen Landschaftsraums als
Naherholungsraum für die Millionenstadt München sind diese Flächen kritisch zu
betrachten; die Beurteilung der Flächen 16 und 17 hängt von Planungen im
Nachbarlandkreis ab. Die Darstellung als „Weißfläche“ würde diesen Gebieten
besser gerecht werden, noch besser wäre die Darstellung als Ausschlussgebiet.
Gebiete 20 bis 23: Diese ergeben zusammengenommen mit 189 ha + 368 ha +
394 ha + 273 ha eine sinnvolle Gesamtgröße für ein durch Windparks mitgeprägtes
Gebiet, zumal sich Erweiterungsmöglichkeiten im Nachbarlandkreis ergeben.
Gebiet 20: Abstände von 800 Metern (statt offenbar 1000 m) zu
den kleinen Dörfern erscheinen ausreichend; Gebietsvergrößerung.
Gebiet 21: Bei diesem Gebiet scheint es einige
Arrondierungsmöglichkeiten zu geben, insbesondere bei dem südwestlich um einen
Aussiedlerhof nahe der St 2073 geschlagenen Abstandskreis und bei dem um
Dietenhausen geschlagenen Abstandskreis. Ein geringerer Abstand zu dem
erstgenannten Hof würde die Errichtung von WEA auf dem zugehörigen Grünland
ermöglichen und somit auch die Akzeptanz bei dem entsprechendem Landwirt
erhöhen (insbesondere, wenn ihm nicht auch der angrenzende Wald gehört).
Dietenhausen besteht nur aus weniger Häusern und durch den Wald gäbe es ohnehin
kaum eine Sichtbeziehung.
Nach
Osten hin scheint eine weitere Arrondierung des Gebiets 21 – bzw. ein durch den
Flußlauf getrenntes gesondertes Gebiet, das aber nach außen wie ein Gebiet
wirkt - möglich zu sein. Hier wäre
wiederum ein Verzicht auf erhöhte Abstande von den kleinen Siedlungen Buch bzw.
Baumgarten möglich.
Weiterhin
sollte eine Ergänzung des Gebietes 21 westlich bis nördlich von Dietenhausen
bis zu einem Abstand von 800 Metern von Lochen und geringeren Abständen zu den
kleinen Siedlungen im Umfeld (Thalham, Schlickenried, Ried) erfolgen.
Damit
sollte in etwa eine Verdoppelung der Fläche des Gebietes 21 erreichbar sein.
Der Flächenzuwachs würde in etwa den Wegfall der Gebiete 16 bis 19 ausgleichen;
insgesamt würde die visuelle Belastung dieses Raumes deutlich vermindert
werden. Der „Preis“ wäre eine gewisse Einkreisung der bislang sehr idyllisch
gelegenen Siedlung Dietenhausen. Dies ist aber in der Gesamtsicht das kleinere
Übel.
Würde
stattdessen auf Gebiet 21 verzichtet werden, um eine Einkreisung von
Holzkirchen zu vermeiden, wäre das auch akzeptabel. Vorgeschlagen wird daher,
den Bereich des Gebiets 21 mit den beschriebenen Vergrößerungen als „Weißfläche“
auszuweisen und der weiteren Entwicklung vorzubehalten.
Gebiet 22: Nachdem es sich bei Otterfing um einen größeren Ort
handelt, mithin mehr Menschen beeinträchtigt werden können, und weil Erweiterungsmöglichkeiten
in Nähe des S-Bahn-Station nicht eingeschränkt werden sollten, sind hier die
vorgesehenen Abstände notwendig.
Gebiet 24: Wegen der Umkreisung von Holzkirchen und der Lage
näherungsweise in Blickachsen der A8 (südliche Fahrtrichtung) ist das Gebiet
zusätzlich problematisch.
Weißflächen westlich und südwestlich von Warngau: Dies liegen
genau in der Längsachse des Tegernsees und somit der Blickachse von
Rottach-Egern über den See sowie in Sichtrichtung von Spaziergängern am Seeufer
in Bad Wiessee und Tegernsee, daher ist Streichung dringend empfehlenswert.
G. Methodik und
Kriterien
Die
visuellen Wirkungsbereiche der Projektstandorte unter Berücksichtigung von
Gelände und Waldbeständen sollten jeweils vor Planverabschiedung ermittelt
werden (einschließlich Fernwirkung) – eine zusammengefasste Ermittlung wäre
auch wesentlich preisgünstiger als eine spätere jeweils getrennte Ermittlung in
Einzelverfahren.
Die
jeweils angegebene Entfernung zur nächstgelegenen 110 kV-Leitung ist bei
kleineren bis mittleren Gebieten irrelevant, da hierfür keine Umspannwerke
gebaut werden, sondern ein Anschluss im bestehenden 20 kV-Netz oder an
bestehenden 20/110 kV-Umspannwerken erfolgt.
H. Gesamtschau
der Vorschläge
Geht
man davon aus, dass moderne Windturbinen bzw. Windparks in 10 km Entfernung
noch eine deutliche visuelle Wirkung haben, und auch in 20 km Entfernung gut
wahrnehmbar sind, jeweils freie Sicht vorausgesetzt, ergeben die vorgelegten
Planungen ein durch die gesamte Region durchgehendes Band mit
Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds durch Windkraftanlagen. Nachts
verstärkt sich der visuelle Eindruck noch durch die zwar unsinnige, aber
vorgeschriebene Befeuerung.
Mit den obenstehenden Vorschlägen würde sich
die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds dagegen auf zwei Bereiche nördlich/westlich
von Schongau und im Halbkreis um Holzkirchen beschränken. Der zentrale Bereich
der Region mit den Erholungsgebieten der Seenplatte und die Sichtachse vom
Tegernsee blieben frei.
Soweit
vorstehend der Konjunktiv verwendet wurde, soll dies bedeuten, dass der
entsprechende Vorschlag im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemacht wird,
aber natürlich eine Überprüfung erforderlich ist. Es könnte weder die Höhenlage
der jeweiligen Gebiete geprüft werden noch deren Windhöffigkeit oder etwaige
schützenswerte Biotope in vorgeschlagenen Arrondierungen geprüft werden. Die
Stellungnahme erfolgt sowohl im Namen der Windland Energieerzeugungs GmbH wie
auch im Namen des Unterzeichners.
Windland
wurde 1990 gegründet, der in München aufgewachsene Geschäftsführer hat bereits
1989 seine erste Windkraftbeteiligung erworben. Eigene Windstromproduktion
erfolgt in einem über rund 20 km2 stark von Windparks geprägten,
landwirtschaftlichen Gebiet in Norddeutschland sowie demnächst in einem rund 40
km2 großen Windpark in der Nordsee (in Bau). Damit werden dann auch
energiewirtschaftlich bedeutende Beiträge geliefert. Isolierte Kleinprojekte
mit einer Handvoll Windturbinen, wie sie im Oberland auch geplant sind, würden
hingegen im Verhältnis zu ihrem Nutzen zu viele Menschen beeinträchtigen und
damit die Akzeptanz für die Windkraftnutzung unnötig beeinträchtigen.
Mit
freundlichen Grüßen
Joachim
Falkenhagen